Die Seele ist ein zartes Gebilde aus Glas
und wenn sie zerbricht,
schneiden ihre Scherben tiefe Wunden in uns.– Calleigh J. Sanders
Kann ein Trauma nicht verarbeitet werden, kann es infolge dessen zur Ausbildung einer Folgestörung kommen.
Darüber schrieb ich in meinem 3. Teil dieser Artikelreihe bereits etwas.
Zu den häufigsten Folgestörungen, die sich primär aus einem Trauma entwickeln können, gehören die Posttraumatische Belastungsstörung (kurz: PTBS) und die Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung, die im angloamerikanischen Raum auch unter dem Begriff “Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung” bekannt ist, und die in der ICD-10, also der internationalen statistischen Klassifikation von Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, mit den Schlüsseln F43.1 bzw. F62.- zu finden sind.
Die Definition, was eine PTBS ist, und durch was sie ausgelöst wird, ist von der AWMF, der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften sehr eng gefasst, um zu vermeiden, dass nicht jedes beliebige Ereignis als Auslöser einer PTBS herangezogen wird.
Von der AWMF wird eine PTBS definiert als
[…] eine mögliche Folgereaktion eines oder mehrerer traumatischer Ereignisse (wie z.B. das Erleben von körperlicher und sexualisierter Gewalt, auch in der Kindheit (so genannter sexueller Missbrauch), Vergewaltigung, gewalttätige Angriffe auf die eigenen Person, Entführung, Geiselnahme, Terroranschlag, Krieg, Kriegsgefangenschaft, politische Haft, Folterung, Gefangenschaft in einem Konzentrationslger, Natur- oder durch Menschen verursachte Katastrophen, Unfälle oder die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit), die an der eigenen Person, aber auch an fremden Personen erlebt werden können.
In vielen Fällen kommt es zum Gefühl von Hilflosigkeit und durch das traumatische Erleben zu einer Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses.
Symptomatisch zeigt sich eine PTBS, wie bereits berichtet, durch
- z.B. Alpträume, Flashbacks, Bilder und/oder partielle Amnesie. D.h. durch Lücken in der Erinnerung und/oder durch Erinnerungen an das Trauma und/oder sich aufdrängende, belastende Gedanken.
- z.B. Schlafsötrungen, vermehrte Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen, Affektintoleranz und/oder Schlafstörungen, sprich Symptome, die auf eine Überregung hinweisen.
- Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma in Verbindung gebracht werden
- emotionale Taubheit, d.h. es findet ein allgemeiner Rückzug statt, es kommt zu einem Interessenverlust und innerer Teilnahmslosigkeit
- findet ein Trauma im Kindesalter statt, so kann sich die Ausprägung der Symptome z.T. verändern. Es kann zu einem wiederholten Durchspielen der traumatischen Situation kommen, aber auch zu Verhaltensauffälligkeiten und/oder z.T. auch aggressiven Verhaltensmustern
Die Symptome einer PTBS können direkt nach erfolgtem Trauma oder auch mit (z.T. mehrjähriger) Verzögerung auftreten. Bei einem verzögertem Auftreten spricht man dann entsprechen auch von einer “verzögerten PTBS”.
Wichtig ist natürlich, dass durch eingehende Diagnostik das Vorliegen einer anderen (oder weiteren) Erkrankung (en) ausgeschlossen werden, und etwaige Vorerkrankungen zu erkenne. Eine PTBS kommt selten alleine vor, sondern ist häufig von Suchterkrankung(en) und/oder Depressionen begleitet, die dann ggf. vorrangig oder gleichzeitig mit behandelt werden werden müssen.
Neben einer Suchtproblematik und Depressionen treten häufig auch körperliche Gesundheitsprobleme, Aggression und starke Schuldgefühle auftreten.
Ein weiteres häufig auftretendes Symptom ist die Dissoziation, bzw. eine dissoziative Störung.
Eine PTBS kann trotz eingehender Untersuchung übersehen werden. Vorallen Dingen dann, wenn
- die Traumatisierungen lange zurückliegen (z.B. Missbrauchserfahrungen im Kindesalter)
- andere Beschwerden scheinbar im Vordergrund stehen, z.B. Depression, Angst
- körperliche Beschwerden, Sucht, Abspaltung von Wahrnehmung und Erinnerung vorliegen
- sich Beschwerden fast auschschließlich auf körperlicher Ebene z.B. in Form von unklaren und anhaltenden Schmerzen zeigen, die auf keine Behandlung ansprechen
- sich Betroffene im zwischenmenschlichen Kontakt (auch mit dem Therapeuten) misstrauisch oder gar feindselig zeigen. Besonders häufig ist dies bei Persönlichkeitsstörungen bzw. Persönlichkeitsänderungen nach Extrembelastung
- schwere körperliche Erkrankungen vorliegen
Exkurs: Dissoziative Störungen
Diese werden definiert als
[…] der teilweise oder völlige Verlust der normalen Integration von Erinnerungen an die Vergangenheit, des Identitätsbewusstseins, der unmittelbaren Empfindung, sowie der Kontrolle von Körperbewegung.
Oder um es ganz einfach zu machen: Dissoziation bedeutet nichts anders als “Spaltung” oder “Auseinanderfallen”.
Bei einer Dissoziation handelt es sich also um einen Vorgang, bei dem etwas, das eigentlich zusammengehört, gespalten wird bzw. auseinanderfällt. In Bezug auf die Psyche bedeutet das das Zerfallen eines zusammengehörenden psychischen Vorgangens in einzelne Teile. Wobei dieser Vorgang nicht mit der Spaltung bei Schizophrenie zu tun hat.
Warum und wie es zu diesem Vorgang des Ab-/Aufspaltens kommt, ist ein viel diskutiertes Thema.
Realtiv einig scheint man sich zu sein, dass es sich bei einer Dissoziation um einen Bewältigungs-, Abwehr- und Schutzmechanismus handelt, der dazu dient, unlösbare und/oder unerträgliche Konflikte oder traumatische Erlebnisse erträglicher zu machen.
Solche Erlebnisse können nicht in das Alltagsbewusstsein integriert werden.
Als Abwehrmechanismus dient er auch dazu, unerträgliche Gefühle, Erinnerungen, Wahrnehmungsinhalte und/oder Körperempfindungen abzuspalten, damit eine belastende Situation erträglicher wird, bzw. um diese überleben zu können.
Es gibt übrigens auch gesunde Formen der Dissoziation, und es gibt wohl kaum einen, der nicht diese auch schon mal in seinem Leben selbst erfahren hat.
Dazu gehören z.B. das “Ausblenden” von Gefühlen und/oder der Wahrnehmung, wenn man sich einem Tagtraum hingibt. Auch ein Schüler oder ein Student, der den einschläfernden Lehrer nicht mehr mitbekommt, weil er nur noch mit “leeren Blick” in die Gegen starrt und “nicht bei der Sache” ist erlebt so einen Zustand.
Gehen wir in den spirituell-magischen Bereich, so kann man z.B. das Eintreten einer Trance als bewusst herbei geführte Dissoziation bezeichnen.
Es ist also nicht jede Art der Dissoziation “krankhaft” oder “unnormal”, sondern eine “Störung” tritt dann ein, wo diese Abspaltung einen Menschen in seinem täglichen Leben, in seiner Funktionsfähigkeit als Person einschränkt.
Doch schauen wir uns den Vorgang der Dissoziation etwas genauer an.
Stellen wir uns einen Menschen vor, der sich in einer lebensbedrohlichen, ausweglosen Situation befindet.
Das Gefühl, dass er vermutlich vorherrschend empfinden wird, ist eine tiefgreifende Angst.
Diese Angst gilt es (von der Psyche und vom Körper) erträglich zu machen.
Der Körper ist in solchen Extremsituationen in einen “Kampf-” oder “Alarmzustand” versetzt. D.h. das Vegetative Nervensystem (das, wie in Teil 1 berichtet, eng mit dem Limbischen System zusammenhängt) versetzt den Körper in einen Zustand, in dem sich Kampf- und Fluchttendenzen einander abwechseln (“Fight or Flight”). Beide haben zum Ziel, dass die äußere Stress-/Problemsituation bewältigt werden kann.


Traumatische Situationen haben im Gegensatz zu anderen Bedrohungs-situationen die Besonderheit, dass es weder die Möglichkeit gibt, sich einem Kampf zu stellen, noch die Flucht anzutreten. In solchen Fällen kommt es dann ggf. dazu, dass der psychische Mechanismus der Dissoziation einsetzt.
Das bedeutet, dass die von dem traumatischen Stress betroffene Person eine Flucht in sich selbst, bzw. in die Wahrnehmung unternimmt.
Das kann z.B. dadurch sein, dass er/sie:
- aus seinem Körper heraustritt
- sich wie ein Außenstehende/r des Geschehens empfindet
- Teile des eigenen Körpers nicht als zu sich gehörend erlebt
- wie über den Dingend schweben
- eine weitere Person schafft,
statt seiner das Trauma erlebt (=>Schmerzreduzierung).
Die Dissoziation ist also ein Mechanismus, der in der traumatisierenden Stress-Situation dazu führt, dass unerträgliche Gefühle (wie Angst) oder Körperempfindungen (wie Schmerzen), in erträgliche überführt werden. Für den Moment ist das die Rettung, doch langfristig entwickelt sich daraus in den meisten Fällen eine Störung, die sich dann in Symptomen manifestiert die der PTBS zugeordnet werden (s.o.).
Was körperlich passiert, wenn eine sog. “Dissoziative Reaktion” eintritt, ist heute noch nicht gänzlich geklärt. Aber eines der wichtigsten Ergebnisse der Hirnforschung ist, dass sich die Funktionsweise des Gehirns unter extremen Stress verändert.
Wie ebenfalls schon angedeutet, gibt es im Hirnstamm zwei Gedächtnissysteme (explitzites und implizites), die für die Stressverarbeitung besonders wichtig sind. Diese speichern Erinnerungen so ab, dass wir wissen, was in der Vergangenheit passierte und diese auch zeitlich einordnen und erzählen können.
Kommt es zu einem Erlebnis mit traumatischem Stressniveau, findet eine Störung statt, wie im Gedächtnismodell des 3. Teil beschrieben:

Die Hippokampusformation (zuständig für zeitliche Einordnung, Zusamenhänge einer Erfahrung, Vernetzung mit Sprache) schaltet sich ab, dafür arbeitet das sog. Amygdala-System unabhängig und ungebremst weiter.
Das Amygdala-System ist vornehmlich bei der Entstehung von Angst beteiligt, sowie für die Bewertung und Wiedererkennung von Situationen und der Analyse möglicher Gefahren.
Das bedeutet, sie beschäftigt sich nur mit den Teilen der Erfahrungen, die die unangenehmsten Gefühlsreaktionen erzeugen, die heftigste Angst, die heftigsten Schmerzen.
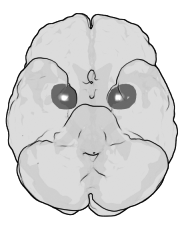
All diese werden im Amygdala-System gespeichert-und zwar ohne jeglichen Zusammenhang und ohne eine Vernetzung zum Sprachzentrum einer Person.
Daraus lässt sich einerseits erklären, weswegen sich traumatisierte Menschen oft nicht oder nur bruchstückhaft an ihr Erleben erinnern können, andererseits findet man hier auch einen Erklärungsansatz dafür, warum bestimmte Auslösereize wie Geräusche, Gerüche, der Klang einer Stimme, Bilder oder ähnliches z.B. heftigste Angstreaktionen und Körpererinnerungen auslösen können (Herzrasen, Übelkeit, Schwindel, Atemnot, Schmerzempfindungen u.a.).
Das traumatisierende Erlebnis wird dadurch immer wieder erlebt, und zwar so, als würde es in diesem Moment grade (wieder) passieren, da der zeitliche und räumliche Zusammenhang und der Beziehungskontext fehlen.
Wären diese vorhanden, könnte man das Geschehene als Erinnerung an ein (weit) zurückliegendes Ereignis einordnen und erkennen, dass dies abgeschlossen ist und von diesem (heute) keine Bedrohung mehr ausgeht.
Doch diese abgespaltenen Traumaanteile verändern sich nicht. Sie werden immer durch äußere und innere Reize ausgelöst (=getriggert), die eine Erinnerung auslösen.
Wichtig ist diesem ganzen Zusammenhang auch, dass es bereits bei einmaligen traumatischen Erlebnissen zu einer Dissoziation bzw. zu einer dissoziativen Störung kommen kann. Besonders Menschen, die sehr früh in ihrem Leben oder/und über einen längeren Zeitraum traumatisiert wurden, und deren einziger Ausweg und Rettung die Dissoziation war, nutzen diesen Schutzmechanismus dann auch in ihrem weiteren Leben in Situationen, in denen es nicht notwendig wäre.
Das Hippocampus-System ist erst ab einem Alter von 12 Jahren voll funktionsfähig, weswegen kleine Kinder besonders häufig dissoziieren, d.h. auch das Kindheitstraumen zu häufigeren und schwereren dissoziativen Störungen führen als Traumata, die in einem späteren Lebensalter stattfinden.
Auf eine “Dissoziative Störung” können Hinweisen
- Erinnerungslücken/Amnesie
- Trancezustände
- Sensibilitäts-und Empfindungsstörungen
- Störungen der Körperwahrnehmung
- Unerklärliche Krampfanfälle
- Störungen der Selbstwahrnehmung oder des Selbsterlebens (“neben sich stehen”)
- Störung der Sinnesempfindung und der Bewegung ohne organische Ursache
- Existens von zwei oder mehr Persönlichkeiten in einer Person (=Dissoziative Identitätsstörung=schweste Form von dissoziativer Störung)
Abschließen zu diesem Exkurs sei noch angemerkt, dass ein traumatisches Geschehen nicht als gesamte Geschichte gesehen, gefühlt, gedacht und körperlich gespürt werden kann, solange Amnesie und Dissoziation die Fragmente, in denen es abgespeichert wurde, voneinander getrennt halten.
Solange Dissoziation und Amnesie anhalten, kann eine Integration nicht stattfinden, die für eine Genesung wichtig ist.
Damit aus einem Ereignis eine “neutrale” Erinnerung gemacht werden kann, braucht unser Gehirn die bekannte Sequenz und Wahrnehmungsstruktur von “Anfang-Verlauf-Ende” sowie Informationen über die Bedeutung eines Ereignisses.
Für die Verarbeitung eines Traumas bedeutet das, dass es erst dann verarbeitbar wird, wenn es und möglich wird die Splitter zusammenzufügen.
Wie bei einem Spiegel, bei dem man nicht mehr erkennen kann, was passiert ist, sondern nur noch sieht das etwas passiert ist.
Doch wieder zurück zur PTBS.
Es gibt leider immer noch die Ansicht, dass psychische Erkrankungen grundsätzlich erst einmal ein Ausdruck von (charakterlicher) Schwäche oder Labilität sind.
Auch bei dem Thema PTBS sind solcherlei Ansichten immer noch weit(er) verbreitet.
Tatsächlicht können auch (psychisch) völlig gesunde Menschen eine PTBS entwickeln.
Allerdings gibt es tatsächlich Faktoren, die einerseits das Risiko an einer PTBS zu erkranken erhöhen und andererseits auch verringern können.
Ich denke, es ist wichtig sich vor Augen zu halten, dass der Organismus durch eine PTBS versucht, eine traumatische, mitunter lebensbedrohliche Situation zu überstehen. Zu aller erst ist also eine PTBS eine gesunde und auch zweckdienliche Reaktion.
Risiko- und Schutzfaktoren
Zu den Faktoren, die das Risiko an einer PTBS zu erkranken erhöhen, zählen belastende Lebensumstände und Lebensereignisse. Sie können einzeln oder in ihrem Zusammenwirken begünstigend auf die Entwicklung einer PTBS wirken.
Es wird dabei unter prätraumatischen (d.h. zeitlich vor dem Trauma liegenden) und posttraumatischen (d.h. zeitlich nach dem Trauma liegenden) Risikofaktoren unterschieden.
Doch sie können auch in der traumatischen Erfahrung selbst begründet sein.
Zu den Risikofaktoren zählen auch lange Dauer und schwere Stärke des Traumas.
Die Erfahrungen in der Traumatherapie zeigen außerdem, dass die Erfahrung von menschlicher Gewalt meist zu tiefgreifenderen Folgen führt, als Unfälle oder Naturkatastrophen.
Außerdem sind Menschen, die bereits unter psychischen Probleme leiden besonders oft betroffen. Auch Menschen, die kein oder nur ein schlecht ausgebildetes Netzwerk besitzen, sind ebenfalls besonders anfällig.
Zu den prätraumatischen Risikofaktoren zählen unter anderem fehlende emotionale Unterstützung der Eltern/Angehörigen, Aufwachsen in Armut, schlechte Schulbildung der Eltern, psychische Störungen mind. eines Elternteils, schlechter Kontakt zu Gleichaltrigen, Kriminalität oder Dissozialität mindestens eines Elternteils.
Im Gegensatz dazu stehen die Faktoren und Lebensumstände, die unterstützend und korrektiv wirken.
Dazu gehören z.B. enge Beziehunge zu den Eltern/Angehörigen, eigener Schulabschluss, Erfolge, soziale Unterstützung.
Diagnostik
Für die Diagnostik einer PTBS gibt es unterschiedliche Richtlinien. Letztlich ist es jedoch so, dass grade in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik an den derzeitigen Diagnosekriterien laut wurde, da diese sehr eng gefasst sind und damit das vielfältige Symptomspektrum von Menschen mit langanhaltenden und schwersten Traumatisierungen unzureichend beschreiben und abdecken.
Ich werde jetzt nicht genau darauf eingehen, doch wer einen groben Überblick haben möchte, möge die Wikipedia bemühen ;).
Da im Bereich der PTBS in den vergangenen Jahren vermehrt geforscht wurde, hat sich gezeigt, dass besonders schwere Formen deutlich vielfältigere Beschwerdebilder zeigen und damit über die bekannten Merkmale und Diagnosekriterien einer “gewöhnlichen” PTBS hinaus gehen. Aus dem Grunde wurde immer wieder die Diagnose der komplexen posttraumatischen Belastungststörung vorgeschlagen.
Auch wenn viel für eine weitere Klassifikationsmöglichkeit spricht, hat sich diese jedoch bisher nicht durchsetzen können, stattdessen werden die Akronyme DESNOS (Disorder Of Extreme Stress Not Otherwise Specified) bzw. Andauerne Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung verwendet.
Die Schwierigkeiten bei der Einführung einer neuen Kategorie besteht zum einen darin, das selbst heute noch die gesellschaftliche Anerkennung von Traumafolgestörungen recht schwierig ist, und andererseits die Bereitschaft eine neue Diagnosekategorie einzuführen im medizinischen Bereich sehr gering ist.
Doch das nebenbei.
Es hat sich im Laufe der Jahre herausgestellt, dass die sehr eng umgrenzten Kategorien der PTBS nicht ausreichend sind, um das große Spektrum von Symptomen, die durch lebensgeschichtlich sehr frühe und/oder sehr schwere und lang andauernde, traumatische Erlebnisse ausgelöst werden können, abzudecken.
Langzeitfolgen, die durch ein Trauma in der Kindheit enstehen können, sind
- körperlichen Beschwerden unklarer Herkunft
- chronisches selbstschädigendens und/oder verletzendes Verhalten
- dissoziative Symptome und
- eine verzerrte kognitive und affektive Selbstwahrnehmung.
Da lang andauernde und extreme Traumatisierungen existenzielle Grundannahmen über den Wert der eigenen Person und die Vertrauenswürdigkeit anderer zutiefst erschüttern, sind die Folgen für die psychische Gesundheit entsprechend umfassend und schwer wiegend.
Entsprechend wurde von der amerikanischen Traumaforscherin Judith Herman (englischer Artikel) eben der Begriff “komplexe posttraumatische Belastungsstörung” vorgeschlagen, um eben ein charakteristisches Symptombild nach einer chronischen Traumatisierung beschreiben zu können.
Zu diesen Symptombereichen gehören
- Veränderungen persönlicher Glaubens- und Wertvorstellung,
- dissoziative Symptome,
- Störungen der Emotionsregulation,
- gestörte Selbstwahrnehmung und
- gestörte Wahrnehmung des Täters, sowie
- Störungen in der Gestaltung von Beziehungen und der Sexualität.
Wie gesagt hat sich die von Frau Herman vorgeschlagene Klassifikation bisher nicht durchsetzen können. Stattdessen findet sich in der ICD-10 neben der akuten Belastungsreaktion und der PTBS die “andauernde Persönlichekeitsstörung nach Extrembelastung”, deren Leitsymptomatik u.a. durch
- Gefühle der Leere und Hoffnungslostigkeit,
- einem chronischen Gefühl von Nervosität,
- Entfremdung,
- eine feindselige oder misstrauische Haltung ggü. der Welt,
- sozialen Rückzug und
- einem Gefühl des ständigen Bedrohtseins
gekennzeichnet ist.
Das Problem bei der Diagnostizierung dieser Folgstörung erklärt sich, wenn man daran denk, dass davon ausgegangen wird, dass sich Persönlichkeitsänderungen erst nach der Pubertät verlässlich einschätzen lassen.
Allerdings findet sich in der psychotherapeutischen Praxis die Situation vor, dass weit häufiger Patienten mit kindlichen Traumatisierungen vorzufinden sind, als Patienten mit Extrembelastungen im Erwachsenenalter. So ist es kaum verwunderlich, dass diese Diagnosekategorie in der Vergangenheit recht wenig Anklang fand.
Spezielle Symptomatik der K-PTBS
Störungen der Emotionsregulation zählen zu den häufigsten Problemen, die bei Menschen mit einer Traumatisierung auftreten, und sie haben besonders weitreichende Folgen bezüglich der Funktionsfähigkeit im Alltag.
Betroffene, die an einer K-PTBS leiden, beschreiben z.B., dass sie bereits bei geringer Alltagsbelastung zu Überreaktionen neigen, bei denen Sie emotional stark beteiligt sind, und dass es ihnen anschließend schwerfällt, sich wieder zu beruhigen und wieder Abstand zu gewinnen.
Es fordert häufig ihre gesamte Aufmerksamkeit und bedarf großer Anstrengung, sich wieder zu beruhigen.
Es kommt nicht selten vor, dass die Betroffenen versuchen sich durch den Missbrauch von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen und/oder durch sich selbst verletzendes Verhalten von belastenden Affekten abzulenken oder innere, unerträgliche Spannungszustände zu beenden.
Zu den weiteren Schwierigkeiten die auftreten können gehören, dass es Betroffenen häufig sehr schwer fällt, Impulse zu steuern und/oder unangenehme und belastende Affekte auszuhalten.
Zu den Folgen, die daraus entstehen können, gehören exzessives Risikoverhalten, Suizidalität und andere selbst-und fremdaggressive Handlungen.
In einer engen Beziehung zum Problem des selbstschädigenden Verhaltens steht ein Bereich, der sowohl unzureichende Selbstfürsorge aber auch unzureichenden Selbstschutz im Alltag umfasst.
Mit der Selbstfürsorge verbunden sind auch Ernährung und Körperpflege, die von den Betroffenen in extremen Fällen vernachlässigt werden können.
Was hinter solchen und ähnlichen Verhaltensweisen steht, wird von den Betroffenen häufig als ausgeprägtes Gefühl der Scham und/oder Schuld beschrieben sowie dem Gefühl, dauerhaft gestört und/oder als Person wertlos zu sein.
Gefühle der Wertlosigkeit, der Schuld, Scham und damit verbunden verzerrte (Selbst)Wahrnehmungen und negative Selbstbeschreibungen sind kennzeichnend für Menschen, die früh-und langandauernd traumatisiert wurden. Solcherlei Denkmuster, die auch als “Fehlinterpretation” oder “Fehlbewertung” bzw. “dysfunktionale Kognition” bezeichnet werden, sind einer therapeutischen Veränderung nur schwer zugänglich.
Doch wenn man sich Scham und Schuldgefühle genauer betrachtet, dann haben sie eine sehr wichtige, stabilisierende Funktion. Man kann sie als Schutzmechanismus des Organismus verstehen, mit dem er versucht eine “psychische Desintegration” zu verhindern oder zu vermindern. Dabei handelt es sich u.a. um eine Störung der Ich-Integration, also der Fähigkeit, sich entsprechend der unterschiedlichen Rollenanforderungen, denen wir im Leben begegnen (Tochter, Vater, Lehrer/in, Bruder,…) einstellen, anpassen und (re)agieren, und auch die Rollen bewusst erleben zu können.
Die Psyche von gesunden Personen zeichnet sich dadurch aus, dass eine Vielzahl von unterschiedlichen “Selbstzuständen” vorhanden ist, die alle zusammen jedoch ein Gefühl von Identiät und Individualität entstehen lassen. Obwohl wir durchaus bewusst diese Wechsel und Schwankungen der Selbstzustände erleben, erleben wir ein Gefühl von Kontinuität, und psychische Gesundheit beinhaltet auch die Fähigkeit, den Zugang zu diesen unterschiedlichen Ich-Zuständen finden zu können.
Die Annahme, dass man “selbst schuld” und/oder schuldig an dem traumatischen Ereignis sei, bietet eine Möglichkeit der Erklärung für das Geschehene, was den Betroffenen helfen kann Gefühle der Macht- und Hilflosigkeit zu vermindern.
Zu der speziellen Symptomatik einer K-PTBS gehört auch ein sehr ausgeprägtes Misstrauen gegenüber anderen, das bis zur Vermeidung jeglicher Art von sozialen Kontakten gehen kann.
Wenn ein traumatisierter Mensch keine oder nur geringe soziale Kompetenzen erwerben konnte, dann verstärken sich die Ängste vor sozialen Kontakt und nicht selten berichten sie davon, dass sie keine engen Freunde oder Bezugspersonen haben.
Häufig kommt es bei einer K-PTBS auch zu Reinszenierungen traumatischer Ereignisse, wobei die Gefahr besteht, wiederholt zu einem Opfer von Ausbeutung und Gewalt zu werden. Diese unbewusst (!) konstellierten Wiederholungen von traumatisierenden Beziehungsmustern sind ebenfalls ein Versuch der Bewältigung des Traumas. Je unterbewusster die pathologischen Beziehungsmuster und der Wunsch nach deren Bewältigung sind, desto größer ist die Gefahr, immer wieder in ähnliche traumatische Beziehungen zu geraten.
Es kann auch passieren, dass ein Opfer selbst zum Täter wird. Man spricht dann von einer Viktimisierung anderer. Das was man selbst erlitten hat, fügt man anderen zu, wobei das Potenzial zu fremdaggressiven Handlungen bei Männern größer zu sein scheint, als bei Frauen, die aggressive Impulse eher gegen sich selbst zu richten scheinen (Studien von 1981 und 1996).
Dissoziative Symptome kommen häufig in Form von Depersonalisation und Derealisation, aber auch als ausgeprägte Amnesie in Bezug auf lebensgeschichtliche Ereignisse vor. Auch stuporöse dissoziative Zustände oder dissoziatives Weglaufen (sog. dissoziaive Fugue) können auftreten.
Dissoziative Reaktionen treten weitestgehend automatisiert auf, und können damit im Allltag zu erheblichen Problemen führen, wenn sie schon bei relativ geringer Belastung auftreten.
Weitere Problembereiche der PTBS
Somatoforme Störungen/Psychosomatik
Auffallend ist, dass früh traumatisierte Menschen besonders häufig an körperlichen Beschwerden leiden, für die keine ausreichenen organischen Ursachen gefunden werden können. Man spricht von “Somatoformen Störungen” oder auch von “Psychosomatik”. Experimentelle Studien von 1995 zeigen, dass Traumata mehr im Körpergedächtnis, bzw. somatosensorischer Erinnerungen haften bleiben als in Form verbaler Erinnerungen. Es kann sogar relativ häufig zu flashback-artigen Körpersensationen kommen, z.B. plötzliche Schmerzen im Zusammenhang mit einer traumatischen Erinnerung. In manchen Fällen scheint es auch so zu sein, dass körperliche Beschwerden der “Preis” dafür sind, der gezahlt werden muss, um weiterhin funktionieren und ja, auch weiterleben zu können. So trägt also der Körper die “Last” der traumatischen Erinnerung.
Fehlende Perspektiven
Ein Problembereich, der sehr häufig übersehen oder gar runtergespielt wird, ist das Fehlen von Zukunftperspektiven. Das Fehlen äußert sich häufig in Form von Interessenlosigkeit, Hoffnungslosigkeit oder/und einer resignierten Lebenshaltung. Als Folgen einer Traumatisierung können persönliche Wertevorstellungen, Grundüberzeugungen und Glaubenseinstellungen zerstört oder entwertet, Vorstellungskraft und die kreative Phantasie, die wir z.B. bei der Suche nach Lösungen für die Probleme des Alltags benötigen, eingeschränkt weden. Eine starke Einschränkung erfährt auch die Freude und Lust an der aktiven Gestaltung des eigenen Lebens und die Fähigkeit Dinge und Aktivitäten, die uns angenehm sind, beizubehalten.
So kommt es, dass traumatisierten Menschen das Leben ohne lohnendes Ziel und sinnlos empfinden. Dadurch, dass es in Folge des Traumas im eigenen Inneren an Stabilität, Orientierung und Halt fehlt, kommt es in Krisensituationen zu einer erhöhten Latenz von Selbstaufgabe und Suizidalität.
Gedanken und Einstellungen ggü. dem Täter/der Tätergruppe
Einstellung und Gedanken gegenüber dem Täter oder der Tätergruppe stellen eine sehr heikle und spezielle Problematik dar. Sie ist bisher noch relativ wenig untersucht. Allerdings zeigen die bisherigen Untersuchungen in auffälliger Weise, dass die Opfer ständig mit dem Täter und seiner Person beschäftigt sind. Sie zeigen darüber hinaus sehr häufig auch eine verzerrte Wahrnehmung des Täters, z.B. in der Form, dass man das Gefühl hat, dass der Täter auch heute noch Macht und Einfluss auf das Leben nehmen kann, auch wenn dies praktisch nicht mehr möglich ist (weil er z.B. verstorben ist oder weit entfernt lebt).
Die Vielfalt und Komplexität der Beschwerden von Menschen, die an einer (komplexen) PTBS leiden, erschließt sich wohl erst dann wirklich, wenn man versucht Vorteile, Wertungen, und auch überalterte Theorien und Vorstellungen beiseite zu schieben und begreift/begreifen kann, dass derlei Symptomatik Anpassungsstrategien und kompensatorische Bewältigung von Defiziten in der Regulation, Ängsten und traumatischen Beziehungserfahrungen sind.
Die Umwelt wird auf Grund der traumatischen Erlebnisse als unsicher, von unvorhersehbaren Gefahren durchdrungen und ja, auch feindlich wahrgenommen und erlebt.
Hinzu kommt, dass den traumatisierten Menschen das Gefühl für die eigenen Kompetenz fehlt, das ihnen durch die Erfahrung, dass die eigenen, einem zugehörigen Affekte und Impulse schwer beherrsch und steuerbar sind, vermittelt wird.
Man erlebt sich in den Flaschbacks, den Alpträumen… all den belastenden Erinnerungen, die sich unkontrollierbar aufträngen, hilflos und in einer quälenden Weise ausgeliefert.
Es entwickeln sich in zunehmenden Maße Ängste, Misstrauen, Rückzugsverhalten und Schwierigkeiten in Bezug auf Kontakte und Beziehungen.
Im Laufe der Zeit kann sich der Einfluss der Symptomatik in so vielen Lebensbereichen niederschlagen und ein so großes Ausmaß annehmen, dass sie sich zu einer Erkrankung mit dem Rang einer Persönlichkeitsstörung “mausert”.
K-PTBS und die Abgrenzung zu Persönlichkeitsstörungen
Ein Thema, das ich hier relativ kurz anschneiden möchte, ist die die PTBS und die Beziehung und Abgrenzung zu Persönlichkeitsstörungen.
Aufgrund der sehr vielfältigen und komplizierten Symptomatik, die ein Trauma nach sich zieht, kommt es häufig vor, dass statt einer PTBS eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wird. Das liegt daran, dass die Symptomatik u.a. Selbstregulationsstörungen und persönliche Einstellungen umfasst.
Besonders schwierig ist die Abgrenzung zur Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) zu sein, denn ihre Symptomatik überschneidet sich z.T. erheblich mit der einer K-PTBS.
Entscheident ist jedoch, dass es sich bei einer K-PTBS schwerpunktmäßig um eine Affektregulationsstörung handelt, während die Hauptproblematik bei einer BPS im wesentlichen in der Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen liegt. Sie ist also mehr eine Störung der Beziehungs- und Bindungsfähigkeit, während die K-PTBS eher eine Störung der Selbstwahrnehmung und Selbstregulation ist.
Weitere Unterscheidungskriterien sind, dass die BPS vornehmlich von häufigen und z.T. sehr heftigen Stimmungschwankungen bestimmt wird, die allerdings eher in euphorischen Bereich liegen, während bei einer K-PTBS depressiv getönte Affekte überwiegen, und dass dissoziative Symptome bei einer K-PTBS notwendiger Weise zur Diagnose dazu gehören. Sie treten hier in der Regel chronifiziert auf und können sich bis zu schweren dissoziativen Störungen entwickeln. Bei einer BPS treten sie hingegen eher vorübergehend als Reaktion auf Belastungen auf.
Dennoch wurde durch Studien auch ein enger Zusammenhang zwischen PTBS und PBS festgestellt. Die K-PTBS sowie die BPS haben darüber hinaus einen sehr starken Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch und körperlichen Misshandlungen, die empirisch gut belegt sind.
Nach einer Studie von 1997 fanden sich z.B. nur bei 4% der Patienten die eine Behandlung suchten, eine PTBS ohne eine greifbare Traumatisierung.
Es hat sich bei Untersuchungen herausgestellt, dass Menschen mit K-PTBS in ihrer Kindheit in der Regel über einen längeren Zeitraum schweren Traumatisierungen ausgesetzt waren. Dabei fiel auch auf, dass es nicht nur einzelne Handlungen, wie etwa physische Misshandlungen oder sexueler Missbrauch, waren, die sich traumatisierend auswirkten, sondern auch die mit desolaten Familienverhältnissen einhergehende Vernachlässigung und/oder Verwahrlosung von z.B. im Sinne psychischer Misshandlungen, fehlender Unterstützung und/oder emotionaler Ansprachen.
Besonders wenn die Traumatisierung vor dem 10. Lebensjahr gegannen/stattfande trifft sie besonders tief, weil sie Phase/n in der Entwicklung des Kindes trifft, in der es besonders leicht emotional verwundet werden können und ein erhöhtes Risiko besteht, dass sich eine psychische Störung entwickelt/entwickeln kann.
Eine Traumatisierung in der (frühen) Kindheit beeinflusst die Entwicklung von Affektregulationen, Stressmodulationen und die Fähigkeit zu sicheren Bindungen. Die negative Einwirkung auf die Modulation von Stress und die Regulation von Affekten wirken sich nicht zuletzt auch negativ auf die Funktionsmuster auf, die neurobiologisch verankert sind und die Basis für den adäquaten Umgang und die Bewältigung von Stress und angstbesetzten Reaktionen.
Medizinisch-psychotherapeutische Behandlung und Verlauf
Wie Ihr Euch anhand der Komplexität vielleicht vorstellen könnt, steht ein Therapeut bei einem traumatisierten Menschen vor vielfältigen Herausforderungen und Problemgebieten. Da die Symptom(komplex)e von Mensch zu Mensch sowohl von ihrer Schwere als auch von ihrer Komplexität her stark variieren können, ist auch jeder Verlauf völlig verschieden und unvorhersehbar.
Es kann sein, dass sich die Auswirkungen eines Traumas eine sehr lange Zeit, nicht oder nur durch einzelne Symptome bemerkbar macht, oder es kann schon zu beginn zu schweren Symptomen kommen.
Es gibt leichtere Formen, bei denen es den Menschen gelingt, sich innerhalb kürzester Zeit zu regenerieren und wieder zu gesunden, dann gibt es jedoch auch Menschen, deren Leben und Sein so tiefgreifend verändert und zerstört wird, dass ihnen die Gesundung nicht gelingt und sie ihr Leben lang in ihrer physischen und psychischen Leistungsfähigkeit eingeschränkt bleiben.
Man muss leider sagen, dass die Neigung zur Chonifizierung der Symptome bei einer (K-)PTBS insgesamt sehr hoch ist.
Erschwerend kommt, wie bereits beschrieben, hinzu, dass eine schnelle Diagnostik einer PTBS auf Grund ihrer vielfältigen und variablen Symoptome sehr erschwert ist, so dass es sein kann, das Menschen auf der Suche nach einer Therapiemethode die ihnen hilft, von einem Arzt/Therapeuten zum anderen tingeln, weil Einzelsymptome (z.B. “nur” Depression) behandelt werden.
Auch wenn Symptome wechseln, sich verändern, teilweise verschwinden oder z.T. kompensiert werden können, so bleiben unbehandelte, übersehene oder falsch behandelte Symptome erhalten, da sie (wie könnte es auch anders sein), nicht von selbst verschwinden.
Ein weiterer Faktor, der sich sowohl auf Prognose als auch in der Behandlung auswirkt, sind die persönlichen psychischen und sozialen Ressourcen (die “protektiven Faktoren”), das Umfeld und die Lebenssituation der/des Betroffenen.
Je weniger günstige Ressourcen vorhanden sind, je ungünstiger und ungesünder das Umfeld und die aktuelle Lebenssituation einer/s Betroffenen ist, desto mehr wird die Verarbeitung eines Traumas erschwert und/oder behindert. Desto größer wird das Risiko, dass sich eine Traumafolgestörung manifestiert und chronifiziert.
Doch nicht nur das bereits bestehende Umfeld und die Lebenssituationen spielen eine Rolle, sondern auch die Tatsache, dass ein Trauma Veränderungen schafft, die mit der Person des traumatisierten Menschen direkt zusammenhängen. Es entstehen in einer zwangsläufigen Folge psychische Probleme (s. Symptome) und damit ablehnende, misstrauische Reaktionen gegenüber anderen Menschen. Man zieht sich zurück, verhält sich in persönlichen Umfeld, auf der Arbeit usw. anders, als man es selbst von sich und andere von einem gewohnt sind. Soziale Beziehungen können ebenso beeinträchtigt sein, wie das Arbeitslebens.
Ggf. kann es zur Arbeitsunfähigkeit und/oder drohender Arbeitslosigkeit führen.
Bei schweren Traumafolgestörungen sogar Arbeitsunfähigkeit und/oder Frühverrentung.
Kinder, die missbraucht oder misshandelt wurden, bekommen Lernschwierigkeiten, was sich in einem mehr oder minder ausgeprägten Abfall der schulischen Leistungen bemerkbar machen kann. Die schulische Entwicklung von traumatisierten Kindern ist (neben der Entwicklung der Persönlichkeit, der sozialen Kompetenzen usw.) grundsätzlich in einem sehr hohem Maße gefährdet.
Dies alles kann sich zu einem sich selbst Teufelskreislauf entwickeln, in dem zusätzlicher Druck, zusätzlich Ängste um die eigene Existenz, um die Lebensgrundlagen etc. pp. hinzugesellen und die bestehenden Symptome (z.B. Depressionen) zusätzlich anheizen und am Leben erhalten.
Bei traumatisierten Menschen kann (je nach Symptombild) die Behandlung in einer reinen Psychotherapie oder in der Kombination von Medikamenten und Psychotherapie bestehen.
Die alleinige Gabe von Medikamenten (d.h. ohne psychotherpeutisches Begleitung) ist bei Menschen, die traumatisiert wurden, in der Regel weder empfohlen noch zweckdienlich, vor allen Dingen wenn sich abzeichnet, dass sich eine Traumafolgestörung entwickelt.
In der Psychotherapie hat sich ein Zweig der Traumatherapie herausgebildet, der sich, wie der Name schon sagt, schwerpunktmäßig auf die Behandlung von traumatisierten Menschen spezialisiert hat. Ein Ziel der speziellen Traumatherapie ist es, dass die Menschen zur Ruhe kommen, und in einem geschützten, sicheren und vertrauensvollen Rahmen über ihre Erlebnisse und Erfahrungen, aber auch die daraus für sie entstandenen Problematiken sprechen können, und dass es zu einer geordneten Verarbeitung des Traumas bzw. der Traumata kommen kann, und es dadurch zu einer Brenzung bzw. der Kontrolle und/oder Auflösung derselbigen kommen kann.
Die Behandlungsansätze sind sehr vielfältig und die Auswahl der Techniken, die oft auch in Kombination miteinander eingesetzt werden, richtet sich nach den inidividuellen Bedürfnissen des/der Patienten/in, und natürlich auch der Ausbildung des Therapeuten. Letztes bedeutet leider auch, dass ein Therapeut, dessen Repertoir an Therapiemöglichkeiten begrenzt ist, ggf. auch nicht auf die Bedürfnisse seines/r Klienten/in eingehen kann, uns sich dann wundert, dass sich keine Besserung einstellt.
Was so lapidar klingt hat allerdings ggf. schwerwiegende Konsequenzen für den/die Hilfesuchende/n. Nicht nur, dass man sich ggf. missverstanden und schlecht aufgehoben fühlt, sondern dass im aller schlimmsten Fall die Verarbeitung durch den Therapeuten selbst verhindert wird. Wo wir dann wieder bei der Bildung eines Teufelskreislaufes wären.
Die psychotherapeutischen Methoden seien hier nur kurz genannt.
Sie reichen von der Psychoanalyse, über Verhaltenstherapie und narrative Verfahren bis hin zum EMDR.
Dazwischen liegen noch Bandbreiten von ganz verschiedenen Ansätzen.
Die Gabe von Medikamenten ist immer so eine Sache, die grade bei Außenstehenden immer recht kritisch beäugt wird. Und ich habe den Eindruck, dass sie sehr häufig mit diversen “Mythen”, Vorurteilen und diffusen Ängsten behaftet ist. Sicherlich haben Psychatrie und Psychotherapie in der Vergangenheit (und leider kommt es heute ja selbst noch oft genug vor) ihren Teil dazu beigetragen.
Nichts desto trotz, die Gabe von Medikamenten kann bei bestimmten Folgestörungen oder ab einem bestimmten Schweregrad der Symptome Sinn machen und angesagt sein.
Psychopharmaka, die in der Regel in Kombination mit einer Psychotherapie eingesagtzt werden (und m.E. eigentlich auch sollten), wirken auf das Gehirn und seine Funktion ein, und beeinflussen das Gleichgewicht der Neurotransmitter, so dass traumabedingte Symptome reduziert werden können.
Das die medikamentöse Behandlung von einer psychotherpeutischen Behandlung begleitet werden sollte hat die Ursache genau in der Tatsache, dass die Wirkstoffe nur und ausschließlich auf die Vorgänge im Gehirn beschränkt sind und nicht ursächlich wirken (können). Sie können daher “nur” unterstützend oder vorbereitend eingesetzt werden.
Welches Medikament eingesetzt wird, hängt im wesentlichen davon ab, welche Symptome im Vordergrund stehen. Die zur Verfügung stehende Bandbreite reicht jedenfalls von Tranquilizern über verschiedene Antidepressiva hin zu Neuroleptika.
Grundsätzlich zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass die Folgen vor allen Dingen bei Menschen mit schweren und komplexen Traumata nie vollständig überwunden werden und sich zurückbilden können.
Trotz therapeutischer Behandlung.
Sie verändern einen Menschen nicht nur “rein” psychisch. Sie führen eben nicht “nur” zu Bildung(en) von limitierenden Denk- und Verhaltensmustern, die sich eben Mal durch Affirmationen, den “reinen, echten Willen” oder ähnlichem *schnipp* verändern lassen, sondern sie betreffen in einem sehr hohem Maße neuroanatomische und neurophysiologische Strukturen und Prozesse des Gehirns.
Das bedeutet, dass trotz (z.T. langjähriger) Therapie, trotz der Einnahme von Medikamenten usw. usf. die Folgen und Nachwirkungen eines Traumas immer mal wieder in Erscheinung treten können.
Die Möglichkeiten, die für Betroffene jedoch durch psychotherapeutische und medikamentöse Behandlungen bestehen sind, dass sich die Nachwirkungen eines schweren Traumas (z.T.) erheblich abschwächen und mildern lassen, so dass ihr Einfluss auf das Leben nicht mehr so schwerwiegend und ausgeprägt ist.
Fazit
Ich hoffe es ist mir mit diesem recht ausführlichen Artikel gelungen, Euch einen Einblick in die sehr komplexe Thematik von PTBS und ihren Folgen zu geben.
Es liegt leider in der Natur der Sache, dass der Artikel dennoch unvollständig ist, und viele Bereiche außen vor lässt.
Mein Anliegen war und ist es aufzuzeigen, dass, entgegen der im allgemeinen leider immer noch vorherrschenden Meinung, eine PTBS und ihre Bewältigung weder etwas mit dem individuellen Willen etwas verändern zu wollen, noch mit persönlicher oder charakterlicher Schwäche, oder dergleichen mehr zu tun hat, sondern dass eine Traumatisierung, besonders dann, wenn sie in jungen Jahren und über einen längeren Zeitraum erfolgte, sowohl neuroanatomische und -physiologische Strukturen und Prozesse verändert, als auch auf die (Entwicklung der) Persönlichkeit eines Menschen einen großen und sehr entscheidenden Einfluss nimmt.
Dementsprechend gestaltet sich die Veränderung der daraus entstehenden Verhaltens- und Denkmuster sehr schwierig, und weder Erfolg noch Ausmaß der möglichen Veränderung können festgelegt, beeinflusst oder/und vorhergesagt werden. Es kann eben auch sein, das aus einem Trauma entstandene Verhaltens-und Denkmuster ein Leben lang bestehen bleiben, egal wie sehr man sich auch darum bemüht, eine Veränderung herbei zu führen.
Auch das hat weder etwas mit (Charakter)Schwäche, Willens-oder Wollenskraft oder ähnlichem zu tun, sondern hängt, wie oben ausführlich beschrieben, mit der Traumatisierung und ihren Auswirkungen auf physische und psychische Vorgänge zusammen.
Quellen und weiterführende Literatur:
AWMF-Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung ICD 10: F 43.1
Deutsches Ärzteblatt-“Die dissoziative Identätsstörung-häufig fehldiagnostiziert”
Gschwend, Gaby-“Nach dem Trauma-Ein Handbuch für Betroffene und ihre Angehörigen”
Heilmann, Maria-“Wenn die Seele splittert-Dissoziation als Überlebensmechanismus”
Hirigoyen, Marie-France-“Die Masken der Niedertracht-Seelische Gewalt im Alltag und wie man sich dagegen wehren kann”
Huber, Michaela-“PTBS, Komplextrauma und Dissoziation-Aus der Geschichte lernen”
Knuf, Andreas + Tilly, Christiane-“Borderline: Das Selbsthilfebuch”
Miller, Alice-“Das Drama des begabten Kindes-Und die Suche nach dem wahren Selbst”
Miller, Alice-“Du sollst nicht merken-Variationen über das Paradies-Thema”
Miller, Alice-“Am Anfang war Erziehung”
Rahn, Ewald-“Borderline-Verstehen und bewältigen”
Reddemann, Luise+Dehner-Rau, Cornelia-“Trauma heilen: Ein Übungsbuch für Körper und Seele”
Röhr, Heinz-Peter-“Ich traue meiner Wahrnehmung-Sexueller und Emotionaler Missbrauch”
Sack, Martin-“Folgen schwerer Traumatisierung-Klinische Bedeutung und Validität der Diagnose komplexe posttraumatische Belastungsstörung”
Wöller, Wolfgang-“Trauma und Persönlichkeitsstörungen: Psychodynamisch-integrative Therapie”
Wikipedia-Trauma, Posttraumatische Belastungsstörung, Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung, Dissoziative Störung, Borderline Persönlichkeitsstörung

Hat dies auf Geschichten einer urbanen Priesterin rebloggt.
*hust*
Hab ich doch glatt die Einstellung fürs Veröffentlichen falsch gesetzt >__<
Nu ist er aber vollständig 😉